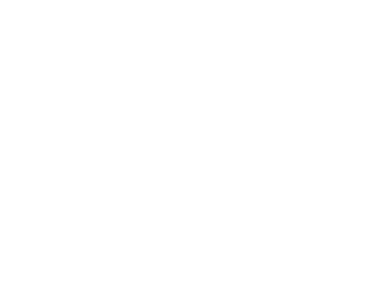Predigt MCC Köln, 27. Januar 2019
Madeleine Eisfeld
Johannes 4,5-14 (Jesus am Jakobsbrunnen)
Liebe Gemeinde,
Jesus und die Samaritaner. Einige von euch werden sich vielleicht erinnern, dass ich vor ein paar Wochen schon einmal über dieses ungewöhnliche Verhältnis gepredigt habe. Damals ging es um den barmherzigen Samariter und dessen Hilfe für einen unter die Räuber Gefallenen.
Heute haben wir es erneut mit einer Vertreterin dieses gebrandmarkten Volkes zu tun. Eines Volkes, das von den frommen Juden gemieden wird. Jeglicher Verkehr mit ihnen ist denen untersagt.
Ich habe einiges über die Samaritaner gesagt. Was ist das für ein Volk? Welche historischen Geschehnisse führten zu dessen Ausgrenzung von Seiten der Juden? Was haben die Samaritaner verbrochen? Womit haben sie all das verdient? Ich möchte es nicht noch einmal wiederholen.
Diesmal ist Jesus selbst Teil der Geschichte. Er wandert durch das Gebiet dieses ausgegrenzten Volkes, und am Jakobsbrunnen kommt es zur Begegnung mit einer Angehörigen.
Jesus wird zum Tabubrecher, und zwar fortwährend. Er dürfte sich überhaupt nicht in der Nähe der Frau aufhalten, geschweige denn mit ihr sprechen. Auch ist es ihm strengstens untersagt, das Wasser zu trinken, das sie ihm reicht. Als gesetzestreuer Jude wäre er verpflichtet, ihr auf der Stelle aus dem Weg zu gehen. Mehr noch, er hätte das Recht, sie zu beleidigen, zu bespucken, zu schlagen, mit Dreck oder Steinen zu bewerfen – stattdessen ist er dabei, seinen Durst am Brunnen dieser unreinen Person zu stillen.
Die Samaritanerin ist eine Mehrfachdiskriminierte. So würden wir mit den Mitteln moderner Sprache die Situation dieser Frau kennzeichnen. Ihr Geschlecht, ihre Rasse und ihre soziale Stellung in der Gesellschaft degradieren sie zur Unperson, zur Nichtexistenz, zu einem seelenlosen Etwas.
Erschwerend kommt hinzu, dass Jesus nicht einfach nur mit ihr spricht, nein, er diskutiert mit ihr über Glaubensfragen. Das wäre nicht einmal einer jüdischen Frau, also einer Angehörigen seines eigenen Volkes, gestattet.
Mit Frauen führt Mann keine theologischen Gespräche. Auch das war vom Gesetz her vorgeschrieben.
So ist es geblieben bis in die heutige Zeit. Glaubt nur ja nicht, das wäre Schnee von gestern. Wir finden solche Meinungen in allen Religionen, überall auf der Welt.
Ein äußerst krasses Beispiel aus der jüngsten Geschichte mag uns das vor Augen führen:
Am 29.Oktober 2009 wurde Margot Käsmann zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt, also zur obersten Repräsentantin der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Noch am selben Tag verkündete das Moskauer Patriarchat der Russisch Orthodoxen Kirche, dass sie mit sofortiger Wirkung die Beziehung zur EKD abbrechen. Es sei, so ihre lapidare Begründung, unzumutbar, mit einer Frau über theologische Dinge zu verhandeln. Ja mehr noch, es käme einer Beleidigung gleich, sich mit ihr überhaupt nur an einen Tisch zu setzen. Als Begründung dienen, wen wundert‘s, die alten verstaubten Argumenten aus der Mottenkiste. Die Frau sei dem Manne in allem Untertan. Sie habe in der Gemeinde zu schweigen. Frauen seien von ihrer Natur aus intellektuell unterentwickelt , etc, etc.
Die alte Platte, immer wieder neu aufgelegt.
Sexismus in Reinkultur, versteckt hinter einem religiösen Feigenblatt.
Ist euch der gravierende Unterschied zu Jesu Verhaltensweise aufgefallen?
Diese Art von hoher Geistlichkeit hat sehr wenig gemein mit dem Wanderprediger aus Nazareth. Sie geben zwar vor, Jesus nachzufolgen. Sie machen uns glauben, dass sie ihm ähnlich werden wollen. Doch auf welche Weise? Etwa indem sie sich Haare und Bärte lang wachsen lassen?
Glauben die wirklich, seiner Botschaft gerecht zu werden, wenn sie ihn optisch imitieren?
Nebenbei bemerkt, niemand weiß, wie Jesus wirklich aussah. Mit Sicherheit trug er die Haare kurz geschoren und hatte, wenn überhaupt, einen Drei-Tage-Bart. Das taten Männer aus der Unterschicht im damaligen Palästina für gewöhnlich. Das hatte vor allem hygienische Gründe. Lange Haare waren das Privileg der Oberschicht.
Am liebsten wäre ich damals nach Moskau gefahren und hätte den Popen eigenhändig ihre langen Zottelbärte abgeschnitten.
Spaß beiseite. Dieses Beispiel soll uns vor Augen führen, wie wenig die führenden geistlichen Autoritäten noch in heutiger Zeit von den Grundaussagen Jesu verstanden haben. Da helfen auch noch so viele akademische Grade nicht viel weiter.
Jesus, der Tabubrecher, macht es ihnen vor. Er begibt sich auf das Niveau der samaritanischen Frau, auch wenn seine Art mit ihr zu reden nach wie vor nicht ganz frei zu sein scheint von einem gewissen paternalistischen Unterton. Aber das Gespräch wird auf Augenhöhe geführt.
Wie selbstverständlich philosophiert Jesus mit ihr über Glaubensfragen. Ist es das nicht auch?
Für die Samaritaner ja, denn bei ihnen galten Frauen weit mehr als bei ihren jüdischen Verwandten, wenn ihnen auch die volle Gleichberechtigung nicht zugesprochen wurde.
Natürlich ist sich Jesus dieses Umstandes bewusst. Auch das eine Provokation.
Interessant wird es, wenn wir den Text weiter lesen.
„Herr, gib mir von dem Wasser zu trinken,“ bittet sie ihn. Jenes Wasser, das ewiges Leben verheißt. Die Frau hat sich dem Anschein nach genau mit den heiligen Texten auseinander gesetzt.
„Geh, ruf deinen Mann und komm wieder hierher!“ bedeutet ihr Jesus.
„Ich habe keinen Mann!“ gibt sie zur Antwort.
„Du hast fünf Männer gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann!“ hält ihr Jesus entgegen.
Er scheint gut über ihr Leben informiert zu sein. Doch woher? Kennt er sie am Ende gar?
Wir wissen es nicht.
Ein erneuter Tabubruch. Denn mit so einer spricht ein gesetzestreuer Juden schon gleich gar nicht.
Ein jüdischer Mann konnte unter Umständen fünf Frauen zur gleichen Zeit sein Eigen nennen. Polygamie war in jenen Zeiten nicht unüblich. Eine Frau durfte das selbstverständlich nicht.
Nicht einmal nacheinander. Offensichtlich lebt die Samaritanerin zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Auch das noch. Es kommt immer dicker.
Und mit solch einer Person führt Jesus ein theologisches Gespräch. Er tut es, weil er erkennt, mit welchem Ernst sie an die Sache geht, wie fasziniert sie von seinen Aussagen ist. Auch sie ist durstig. Durstig nach Erlösung, durstig nach Erkenntnis, begierig, das Reich Gottes in sich aufzunehmen.
Jesus ist bereit, es ihr zu vermitteln; ihr Glaube allein ist ausreichend, um seiner teilhaftig zu werden.
Für ihn ist die Sache eindeutig. Die Tür zum Himmel steht allen offen, und keine irdische Instanz hat das Recht, sie zu versperren. Nur Gott allein könnte es, aber sie tut es nicht. Sie lädt alle ein, alle, ausnahmslos. Jesus ist der Überbringer dieser Einladung. Er übermittelt sie vor allem den an den Rand gedrängten, den Ausgestoßenen, den Abgehängten, wie wir sie in unserer modernen Sprache heute bezeichnen würden. Er übermittelt sie jenen, die nach der Vorstellung der Frommen und Gelehrten als unwürdig erscheinen, unter Gottes Angesicht zu treten.
Die samaritanische Frau wäre wohl nie auf die Idee gekommen eine Synagoge zu betreten.
Man hätte sie dort gar nicht eingelassen. Ihr Geschlecht, ihre Rasse, ihre soziale Stellung in der Gesellschaft und ihr Ruf als vermeintliche Hure grenzen sie von vorn herein aus.
Da gibt es keine Kompromisse.
So geschieht auch heute noch, wenn auch nicht mehr so verbal wie zu Jesu Zeiten. Auch kommt es darauf an, welche heilige Stätte wir zu betreten gedenken.
Für mich als Transfrau ist es stets ein Risiko, mich an solchen Orte zu zeigen.
In einer ganzen Reihe von Kirchen und Moscheen musste ich schon unangenehme Erfahrungen machen, wenn man mir zu verstehen gab, dass ich in ihren Augen eine unerwünschte Person bin, dass es unschicklich für Leute wie mich sei, eine heilige Stätte zu betreten. Andere könnte sich etwa durch meine Anwesenheit in ihrer Andacht gestört fühlen.
Ich frage mich immer wieder, wie es zu solch einer Pervertierung des Glaubens kommen konnte. Haben Leute, die so etwas sagen, nichts von den Aussagen Jesu verstanden?
Allem Anschein nach nicht.
Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu wiederholen: Religionen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer Rasse, ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrer sexuellen Orientierung etc ablehnen, ihnen den Zutritt zu sakralen Orten verweigern, sie von Kulthandlungen ausschließen oder durch verletzende Äußerungen diffamieren, handeln nicht im Sinne einer göttlichen Autorität. Sie dienen keiner Religion, sondern einzig und allein einer von Menschen erdachten Ideologie.
In Folge dessen stünden ihnen auch nicht jene Privilegien zu, die Religionsgemeinschaften üblicherweise genießen, zum Beispiel den Schutz durch staatliche Institutionen.
Wir können uns stets davon überzeugen, dass dem leider nicht so ist.
Unter dem Schutzmäntelchen der freien Religionsausübung ist so gut wie alles erlaubt.
„Gott will es!“ Diese verhängnisvolle Parole aus den Zeiten der Kreuzzüge hat ihre Schärfe niemals verloren.
Gottes Wille, wer kann ihn ergründen? Immer genau wissen, was Gott will, was für eine Anmaßung. Womöglich haben wir eine leichte Ahnung, eine Vermutung, mehr aber auch nicht. Helfen können uns hier vor allen die Aussagen Jesu. Sie sind ein möglicher Schlüssel zur Ergründung von all dem, was wir als Gottes Wille betrachten.
Die samaritanische Frau lässt sich darauf ein. Sie ist bereit, die Botschaft, die ihr Jesus überbringt, anzunehmen, auch wenn sie sich der Tatsache bewusst ist, dass es für eine wie sie unter den damaligen Umständen sehr schwierig wird. Sie erkennt, dass dieser Jesus etwas ganz neues verkündet; etwas, das mit den alten Vorurteilen aufräumt; etwas, das Grenzen überwindet, alte Feindschaften auslöscht und durch Vertrauen und Verständigung ersetzt. Die lange getrennten Völker können wieder zueinander finden.
Diese Verheißung gilt Juden und Samaritanern gleichermaßen und darüber hinaus allen Völkern, auf dem ganzen Erdkreis.
Jeder und jede ist eingeladen, daran mitzuwirken, das Reich Gottes zu verwirklichen.
Doch wo beginnen?
Das Reich Gottes wächst im Herzen jedes Menschen. Erst dann, wenn wir unser Herz freigemacht haben für Liebe und Mitgefühl, für Harmonie und Verständigung, für die Bereitschaft, in Frieden mit all unseren Nachbarn zu leben und auch jene akzeptieren, die eben nicht so sind wie wir selbst, die anders leben, anders lieben, anders denken, dann erhalten wir den Schlüssel und können eintreten.
Alle sind aufgerufen, an sich zu arbeiten, jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick.
Somit ist jeder und jede ein winzig kleiner Baustein im Gefüge eines großen Netzwerkes, das einmal die gesamte Welt umspannen könnte.
Die Frau am Jakobsbrunnen erkennt. Die heilige Ruach, die Weisheit, hat sich einen Zugang zu ihrer Seele verschafft und hat sie erleuchtet. Sie schöpft aus der Quelle des Wissens, deren Symbol der Brunnen ist. Jakob, sowohl Stammvater Israels als auch der Samaritaner, hat ihn einst seinem Sohn Josef vermacht. Seit jenen Tagen wartet die Quelle der Weisheit darauf, den Sucher oder die Sucherin zu erfrischen.
„Du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief!“ stellt die Frau fest. Jesus ist also auf ihre Mithilfe angewiesen, um seinen Durst zu stillen. Sie gewährt sie ihm, und indem sie das tut, kann sie auch ihren eigenen Wissensdurst für alle Zeiten löschen.
„Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm/ihr gebe, wird niemals mehr durstig sein“ verheißt ihr Jesus.
Eine sehr häufig verwendete Metapher in vielen Mythologien der Menschheit. Der Trank des Wissens, der Stein der Weisen, der heilige Gral, es gibt viele Bezeichnungen.
Für uns kommt wohl am ehesten der heilige Geist in Frage, die heilige Ruach. Da ist sie wieder, sie will uns einfach nicht loslassen, diese geheimnisvolle, göttlich-weibliche Energie, die alles durchdringt. Hat sie uns einmal erfasst, dann verändert sie unser ganzes Wesen von Grund auf.
Ein anderes, sehr bekanntes Symbol des Lebens ist das Wasser. Viele Male kommt es in dieser Bedeutung in den biblischen Geschichten vor. Das Land der Verheißung ist ein Wüstenland, trocken, sonnig und heiß. Dort ist jeder Tropfen kostbar. Auch das wissen Juden und Samaritaner gleichermaßen zu schätzen.
Ein Brunnen stellte somit eine ganz wichtige Wegstation für den Wanderer/die Wanderin in der Wüste dar. Wehe denen, die sich, nachdem sie sich unter Aufbringung letzter Kraftreserven durch den Glutofen der Steinwüste schleppen mussten, dort nur noch einen ausgetrockneten Brunnen vorfanden. Das hatte unweigerlich den Tod zur Folge.
Im Wasser steckt die Lebensenergie schlechthin. Ohne Wasser kein Leben.
Somit verwendet auch Jesus dieses Ursymbol des Lebens, um den Menschen in anschaulicher Weise zu verdeutlichen, was er ihnen sagen will. Damit konnten die meisten etwas anfangen, auch dann, wenn sie nicht über eine höhere Bildung verfügten. Diese Symbolsprache ist allen zugänglich.
So wie das Wasser den ausgedörrten Körper wieder mit neuer Energie versorgt, kann die heilige Geistkraft die Seele zu neuem Leben erwecken.
Körper und Geist gehören zusammen, sie bilden eine Einheit, dieser Umstand ist Jesus nicht unbekannt. Deshalb begegnet er uns in vielen anderen seiner Geschichten und Gleichnisse auch als Heiler, der sich zunächst vordergründig der körperlichen Gebrechen der Menschen annimmt. Aber indem er das tut, befreit er auch die gefangene Seele aus ihrem dunklen Verlies.
Ausgrenzung macht krank, zunächst die Seele, schlussendlich auch den Körper.
Jesus ist sich der Tatsache bewusst, dass Menschen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung ausgegrenzt sind, in ganz besonderem Maße leiden. Jene, die an den Rand gedrängt wurden, bedürfen daher auch eines ganz besonders heilsamen Trankes. Er ist bereit, ihn zu verabreichen. Ohne weitgehende Vorbedingungen. Lediglich die Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen, verlangt er ihnen ab.
Er erkennt, dass die samaritanische Frau diese Bereitschaft in sich trägt, und er kommt ihr entgegen.
Es kann durchaus sein, dass die Frau schon seit längerer Zeit bereit war, sich auf das Neue einzulassen, ihr Leben bewusst zu verändern, doch was nützt ihr die Bereitschaft, wenn sie niemanden hat, der ihr die Hand reicht?
Alle ausgegrenzten Menschen, insbesondere Mehrfachdiskriminierte, brauchen ein Gegenüber, das ihnen auf die Beine hilft. Sie schaffen es nicht aus eigener Kraft.
In einem alten Sprichwort aus der islamischen Sufi-Tradition heißt es sehr treffend: „Eine Gefängnistür lässt sich nur von außen öffnen. Ein anderer muss sie dir auftun, um dir den Weg in die Freiheit zu bahnen.“
Wenn ich einer Minderheit angehöre, deren Rechte beschnitten sind, dann nützt mir auch eine noch so tiefgründige Psychotherapie sehr wenig, oder all die Achtsamkeitsübungen, die ich in meinem Leben machen werde.
Wer in der 50er Jahren als Schwarzer in den US-amerikanischen Südstaaten leben musste oder im Südafrika zu Zeiten der Apartheit, hatte einfach nur ganz schlechte Karten. Und was Schwule, Lesben oder Transleute zu allen Zeiten in vielen Regionen der Welt erleiden mussten und müssen, brauche ich sicherlich nicht zu thematisieren.
Solange gesetzliche, soziale oder religiöse Bestimmungen, oder einfach nur die negative Einstellung der Bevölkerungsmehrheit, eine echte Emanzipation vereiteln, ist all das Gerede von Selbstfindung nur eine leere Worthülse ohne Bedeutung.
In unserem konkreten Fall ist es der Ausschließlichkeitscharakter einer Religion, einer Gemeinschaft, die ein göttliches Wesen für sich allein beansprucht. Ein auserwähltes Volk, ein Mensch, wird als dessen Angehöriger geboren. Es gibt keinen Eintritt von außen, kein Überwechseln.
Gott wählt sich die Menschen aus. Auch Jesus tut das. Seine Auswahl aber kennzeichnet etwas Einzigartiges. Er lässt niemanden außen vor. Er nimmt die Menschen so wie sie sind.
Das Gesetz findet in ihm seine Erfüllung.
Somit werden auch die Samaritaner wieder Teil der Gemeinschaft jenes Gottes, mit dem sie vor Zeiten einen ewigen Bund schlossen.
Jesus hebt das Edikt auf, das sie einige Jahrhunderte zuvor zu Ausgestoßenen machte. Unser Gott ist euer Gott, ruft er ihnen zu. Mehr noch, er/sie ist Gott der gesamten Völkergemeinschaft.
Nie wieder soll es in Zukunft Ausgestoßene geben, das ist der Kern seiner Botschaft. Ein kleiner Blick nach draußen genügt jedoch, um erneut zu resignieren. Wie wenig hat sich seit jener Zeit davon verwirklicht.
Ausgrenzung, Abgrenzung, Diskriminierung sind auch heute an der Tagesordnung, nicht wenige berufen sich dabei ausgerechnet auf Jesus, so wie unser Beispiel vom Anfang verdeutlicht.
Ächtung im Namen des Befreiers. Wieder glauben Menschen, ein Exklusivrecht auf Glaubensfragen zu besitzen. Sie gehen davon aus, dass sie ihre eigene Identität nur dann in Fülle leben können, wenn sie anderen das Recht dazu absprechen. Erneut wird die Gesetzestreue über die Liebe gestellt.
Solange solche Meinungen mehrheitsfähig sind, ist das Reich Gottes nicht verwirklicht.
Machen wir uns auf den Weg .
Wir sind aufgefordert, unseren speziellen Jakobsbrunnen zu suchen, jene Quelle geistigen Lebens, die Gott eigens für uns und unseren Blick geschaffen hat.